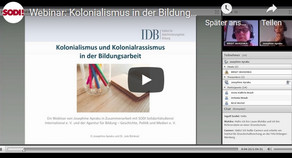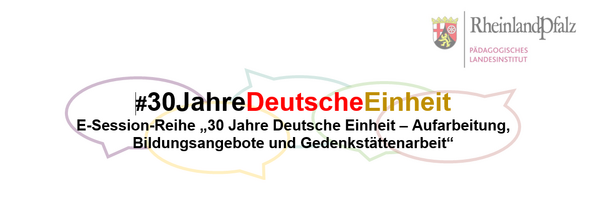Kolonialismus und Rassismus
Januar-Februar 2021
1. Kolonialismus und Rassismus - Fachtagungen Februar 2021
2. Kolonialgeschichte im Unterricht
Kolonialismus und Rassismus - Fachtagungen
Online-Fachtagung des Referat 1.33 Gesellschaftswissenschaften des Pädagogischen Landesinstitutes Rheinland-Pfalz: Zur Verbindung von Kolonialismus und heutigem Rassismus in Deutschland
MONTAG, 22.02.2021 - 09:00 UHR BIS 16:00 UHR
Programm
09:00 Uhr: Eröffnung
• Grußwort von Herrn MinDg. Bernhard Bremm (Leiter Abt. 4C Ministerium für Bildung Rheinland-Pfalz)
09:30 Uhr: Keynote / Fachvortrag Themenfeld „Kolonialismus – Rassismus“
• Katharina Oguntoye, Historikerin und Kuratorin / Gründerin des interkulturellen Netzwerk Joliba in Berlin
11:00 Uhr: „Digitales Sofa“ / Diskussion
• Miguel Vicente, Beauftragter der Landesregierung RLP für Migration und Integration
• Katharina Oguntoye, Historikerin / Joliba Berlin
• Ronny Hollstein, PL-Referent für Extremismusprävention und Demokratiebildung
• Kamady Fofana, Lehrer an einer BBS / Fortbildner
• Nadine Golly, Sozialwissenschaftlerin und Psychosoziale Beraterin / Kollektiv "Karfi"
• Anne Chebu, Journalistin beim Hessischen Rundfunk (Moderation)
- Pause -
14:00 Uhr: Workshops
• „Handlungsoptionen zur Intervention in der Schule“ (Kamady Fofana)
• „Afrikabilder im (Erdkunde)-Unterricht“ (Dr. Inken Carstensen-Egwuom)
• „Wenn Rassismus ehrlich wäre… Kritisches Weißsein für die eigene Arbeit im Klassenzimmer und beyond. Perspektiven für Lehrkräfte“ (Nadine Golly) (Laura Digoh-Ersoy )
ANMELDUNG / KONTAKT:
https://sozialkunde.bildung-rp.de/veranstaltungen/kolonialismus-rassismus.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fachtagung
Was ismus: Reflexion und Widerstand. Eine Fachtagung zum Thema Empowerment und Empowersharing
Historisches Museum Frankfurt und Bildungsstätte Anne Frank
26.-27.02.2021
ANMELDUNG / KONTAKT:
historisches-museum-frankfurt.de/sites/default/files/uploads/faltblatt_fachtagung_rassismus.pdf
Kolonialgeschichte im Unterricht
30 Jahre Deutsche Einheit
Oktober-Dezember 2020
Internationaler Tag der Demokratie - 15. September
September 2020
2007 erklärte die Generalversammlung der Vereinten Nationen den 15. September zum Internationalen Tag der Demokratie, um die Grundsätze der Demokratie zu stärken und zu verteidigen.
Moodle-Kurs ![]() "Straße der Demokratie" (PL, Schule online)
"Straße der Demokratie" (PL, Schule online)
Video ![]() "Wie schmeckt eigentlich Demokratie?" (KAS)
"Wie schmeckt eigentlich Demokratie?" (KAS)
Video ![]() "Wie funktioniert Demokratie?" (ZDFtivi, logo!)
"Wie funktioniert Demokratie?" (ZDFtivi, logo!)
Text ![]() "Internationaler Tag der Demokratie" (Hanisauland)
"Internationaler Tag der Demokratie" (Hanisauland)
Material-Hinweise und Verlinkungen finden Sie ![]() hier.
hier.
Historisches Gedenken am Beispiel des Europäischen Holocaust-Gedenktages für Sinti und Roma am 2. August
August 2020
 In Europa wurden Sinti und Roma mit der Herausbildung der Territorialstaaten ausgegrenzt. Während des Holocausts wurden über 500.000 Sinti und Roma Opfer der Nationalsozialisten. Der Völkermord an ihnen – in der Sprache der Roma „Porajmos“ genannt – wurde erst 1982 von der Bundesregierung anerkannt. Seit fünf Jahren gibt es einen europäischen Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma, der am 2. August begangen wird. An diesem Tag wird an die letzten Sinti und Roma erinnert, die im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau ermordet wurden.
In Europa wurden Sinti und Roma mit der Herausbildung der Territorialstaaten ausgegrenzt. Während des Holocausts wurden über 500.000 Sinti und Roma Opfer der Nationalsozialisten. Der Völkermord an ihnen – in der Sprache der Roma „Porajmos“ genannt – wurde erst 1982 von der Bundesregierung anerkannt. Seit fünf Jahren gibt es einen europäischen Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma, der am 2. August begangen wird. An diesem Tag wird an die letzten Sinti und Roma erinnert, die im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau ermordet wurden.
Die Bedeutung des Gedenkens hebt Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, hervor: „Europa sieht sich heute wieder einem neuen Nationalismus, Antiziganismus und Antisemitismus gegenüber. In der letzten Zeit wurden wir Zeugen zahlreicher rechtsterroristischen Mordanschläge in Deutschland und in anderen europäischen Ländern. Historisches Gedenken ist immer auch eine gelebte Verpflichtung für die Gegenwart und Zukunft. Wenn wir heute an die Verbrechen des Nationalsozialismus und den Holocaust erinnern, müssen wir gleichzeitig Rechtsstaatlichkeit und Demokratie verteidigen.“
Quellen:
https://www.bpb.de/apuz/33270/sinti-und-roma
Material-Hinweise und Verlinkungen finden Sie ![]() hier.
hier.
Ferien und Urlaub in der DDR
Juli 2020
 Das Thema des Monats Juli ist passend zu den Sommerferien gewählt: Wir werfen einen Blick auf Ferien und Urlaub in der DDR.
Das Thema des Monats Juli ist passend zu den Sommerferien gewählt: Wir werfen einen Blick auf Ferien und Urlaub in der DDR.
Die großen Ferien waren auch in der DDR zwischen Anfang Juli und Ende August.
Viele Schülerinnen und Schüler fuhren dann in die Kinderferienlager, die bereits seit 1949 staatlich organisiert wurden. So konnte die DDR-Führung auch die Ferienzeit zur sozialistischen Erziehung der Kinder und Jugendlichen nutzen.
Preiswert konnten Familien einen Urlaub in den FDGB-Ferienheimen machen, allerdings oblag die Entscheidung, wer fahren durfte, den Ferienkommissionen der Betriebe. Auf einen Urlaub in einem der staatlichen Erholungsheime musste man manchmal jahrelang warten. Viele Möglichkeiten, privat Urlaub zu machen, gab es dagegen nicht. Dennoch konnte man – wenngleich es keine Reisefreiheit gab – Urlaub im eigenen Land oder aber auch in den „sozialistischen Bruderstaaten“ machen.
Bildquelle: ![]() katermikesch (
katermikesch (![]() Pixabay-Lizenz)
Pixabay-Lizenz)
17. Juni 1953 – Volksaufstand in der DDR
Juni 2020
Am 17. Juni 1953 protestierten über eine Million Menschen in der DDR und in Ost-Berlin. Sie forderten freie Wahlen sowie den Rücktritt der SED-Regierung und äußerten ihre Unzufriedenheit über Repression und wachsende soziale Probleme. Bereits im Laufe des Nachmittags wurden die Hoffnungen der Menschen zerstört: Sowjetische Panzer schlugen den Aufstand nieder.
Die Bedeutung des 17. Juni für die Nachkriegsgeschichte konnte damals noch niemand ahnen: Aus einem Arbeiterprotest entwickelte sich in wenigen Stunden ein politischer Volksaufstand für Einheit, Recht und Freiheit.
Ehemaliger Tag der Deutschen Einheit
"Das Gedenken an den Aufstand wurde zum nationalen Anliegen. Nur wenige Tage nach dem Aufstand verabschiedete der Deutsche Bundestag mit überwältigender Mehrheit gegen die Stimmen der KPD das "Gesetz über den Tag der deutschen Einheit".
Durch das Gesetz vom 4. August 1953 wurde der 17. Juni in der Bundesrepublik Deutschland zum gesetzlichen Feiertag erklärt und zehn Jahre später durch Proklamation des Bundespräsidenten Heinrich Lübke vom 11. Juni 1963 zum "nationalen Gedenktag" erhoben. Bis zur Wiederherstellung der Deutschen Einheit im Jahr 1990 wurde der 17. Juni als "Tag der Deutschen Einheit" begangen.
Nach Wiedererlangung der Deutschen Einheit wurde der 3. Oktober zum "Tag der Deutschen Einheit" erklärt. Das Gesetz vom 4. August 1953 wurde aufgehoben, die Proklamation des Bundespräsidenten vom 11. Juni 1963 hat aber nach wie vor Gültigkeit. Der 17. Juni ist seitdem Gedenktag."
Quelle: https://www.lpb-bw.de/17-juni
MATERIALSAMMLUNG
| Artikel
| Audio- und Video-Dateien
|
| Text-Quellen | Bild-Quellen
|
| Zeitzeugenberichte Virtuelle Ausstellung Materialien in einfacher Sprache | Unterrichtsmaterialien
|
Die Corona-Pandemie aus der Sicht des Fachs Geschichte - Historische und erinnerungskulturelle Perspektiven
Mai 2020
„Diese Pandemie ist eine demokratische Zumutung, denn sie schränkt genau das ein, was unsere existenziellen Rechte und Bedürfnisse sind, die der Erwachsenen genauso wie die der Kinder.“ (Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Merkel vor dem Bundestag am 23.04.2020).
Die Geschichte der Seuchenbekämpfung ist schon immer ein Wettlauf gegen die Zeit gewesen. Dennoch ist es mittlerweile gelungen, bestimmte Infektionskrankheiten einzudämmen. Bei dem Kampf gegen neue Seuchen und Pandemien greifen wir dabei noch immer auf viele Maßnahmen zurück, die bereits zur Bekämpfung von Pest und Cholera eingesetzt worden sind. Denn mit Abschließungsmaßnahmen wie Isolation und Kontaktverboten versucht man auch heute noch gegen die unsichtbare Gefahr anzugehen, wenngleich neue Entwicklungen wie die "Corona-App" hinzukommen.
In den vergangenen 100 Jahren versetzten mehrere Pandemien - so die Spanische Grippe, die Asiatische Grippe, die Hongkong-Grippe oder SARS - die Welt in Aufregung. Die zweitgrößte Pandemie des 20. Jahrhunderts, die Asiatische Grippe, erreichte 1957 die beiden deutschen Staaten. Während zunächst noch vor einer "Dramatisierung" der Situation gewarnt und eine Beschwichtigungspolitik verfolgt wird, sieht die Situation ein paar Mo nate später bereits ganz anders aus und die Infektionsraten steigen enorm an.
nate später bereits ganz anders aus und die Infektionsraten steigen enorm an.
Im Gegensatz zur derzeitigen Corona-Pandemie blieben die Schulen weitestgehend offen, es sei denn, die Hälfte einer Klasse war erkrankt. Zur Prävention empfahl man nicht das gründliche Händewaschen, sondern - heute nicht mehr denkbar - das Einnehmen "formalinfreisetzender Tabletten" oder das "Gurgeln mit Wasserstoffsuperoxid", wie in einem Hintergrundbericht, der damals im "Süddeutschen Rundfunk" lief und im ![]() SWR2 Archivradio hinterlegt ist, zu hören ist.
SWR2 Archivradio hinterlegt ist, zu hören ist.
Der historische und erinnerungskulturelle Blick auf Pandemien und der Gegenwartsbezug zu Corona eignet sich auch für eine Unterrichtsstunde oder gar -einheit im Geschichtsunterricht. Dabei gibt es verschiedene Anknüpfungspunkte zum Lehrplan. Hierzu haben wir verschiedene Materialien zusammengestellt, die zur Anregung für den eigenen Unterricht dienen.
Pandemien in Vergangenheit und Gegenwart - Historische und erinnerungskulturelle Perspektiven
![]() Kurzer historischer Überblick über Influenza-Pandemien
Kurzer historischer Überblick über Influenza-Pandemien
![]() Kommentierte Literatur- und Linkliste
Kommentierte Literatur- und Linkliste
![]() Unterrichtsideen mit Hinweisen zu entsprechenden Materialien
Unterrichtsideen mit Hinweisen zu entsprechenden Materialien
Unterrichtsbeispiel "Die Ruhrepidemie 1962 in der DDR im Vergleich zur Corona-Pandemie 2020: Epidemien - Propagandamittel im Kalten Krieg?"
Unterrichtsbeispiel "Umgang mit Grippe-Epidemien im getrennten Deutschland: War die Diktatur der DDR der westlichen Demokratie in der BRD überlegen?"
Lernmodul auf der Lernplattform "segu": "![]() Spanische Grippe 1918. Corona-Pandemie 2020. Ein Vergleich"
Spanische Grippe 1918. Corona-Pandemie 2020. Ein Vergleich"
Unterrichtmaterial "![]() Die Spanische Grippe - wie eine Pandemie die Welt verändert" (Landesbildungsserver Baden-Württemberg)
Die Spanische Grippe - wie eine Pandemie die Welt verändert" (Landesbildungsserver Baden-Württemberg)
Netzfundstück: "![]() Corona-Krise: Welche Folgen hat die Pandemie für Demokratien?", Interview von Lea Schrenk mit Suzanne S. Schüttemeyer, BpB, 20.05.2020.
Corona-Krise: Welche Folgen hat die Pandemie für Demokratien?", Interview von Lea Schrenk mit Suzanne S. Schüttemeyer, BpB, 20.05.2020.
Ergänzung vom 13.01.2021:
Themenblätter im Unterricht (Nr. 125): ![]() Aus Seuchen lernen? (BpB)
Aus Seuchen lernen? (BpB)
![]() Handreichung "Seuchen und Gesundheit. Unterrichtsmaterialien zur Medizin- und Sozialgeschichte Hamburgs" (Li Hamburg, 2020)
Handreichung "Seuchen und Gesundheit. Unterrichtsmaterialien zur Medizin- und Sozialgeschichte Hamburgs" (Li Hamburg, 2020)
Ergänzung vom 19.03.2021:
![]() Alzey im Fieber. Die „Spanische Grippe“ 1918/19 (regionalgeschichte.net)
Alzey im Fieber. Die „Spanische Grippe“ 1918/19 (regionalgeschichte.net)
Bildquelle: ![]() Tumisu (
Tumisu (![]() Pixabay Lizenz)
Pixabay Lizenz)